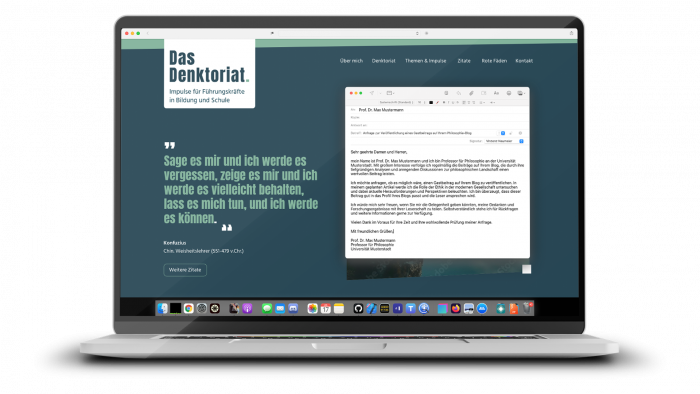Gemeinsames Essen oder
Dinner for one
War Essen jahrhundertlang für die meisten Menschen ein meist sättigendes Mittel zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit, so gab es in der Menschheitsgeschichte immer schon die die reine Nahrungsaufnahme überhöhende Interpretation, so zum Beispiel vom Agapemahl der ersten Christen hin zum Sakrament der Eucharistie und der Heiligen Kommunion. Essen war immer auch schon Statussymbol und Abgren-zungsmittel für gesellschaftliche Schichten. Wer dick war, war reich.
Ab dem bürgerlichen Zeitalter kam eine neue Bedeutung hinzu: Das gemeinsame Essen im Familienkreis oder das einer Hofgemeinschaft. Ihre größte Bedeutung war ihr identitätsbildender Charakter. Bewusst oder unbewusst waren es die festen Mahl-Zeiten, die nicht nur den Tag strukturierten, sondern die Gemeinschaft identifizierte und stärkte. Ein gelungenes Mahl brauche, so habe ich irgendwo einmal gelesen, vier Voraussetzungen: etwas Gutes zu essen, einen brauchbaren Wein, liebe Menschen und genügend Zeit.
Dies sind (oder waren?) die Elemente, warum Essen für den Mensch so wichtig ist: Neben dem Essen und dem Getränk eine dazugehörige Gemeinschaft und die Zeit, die man sich dafür nimmt.
Man spricht ja sogar von der „Mahl-Zeit“. Für die Familie war diese Zeit auch der Raum, sich über den Tag auszutauschen, zu erleben, was dem Anderen wichtig war oder was ihn belastet. Und vielleicht noch essentieller: Hilfe zu erhalten, Lösungen zu finden.
Nun im Zeitalter der Singularisierung sind es eher zwei andere Trends, die die Esskultur bestimmen.
Der erste: Das Essen als Chance der Profilierung, es anderen zeigen zu können, wie designed die eigene Kücheneinrichtung ist oder was man an Exotischem auftischen kann.
Der zweite Trend hängt ebenso mit der Individualisierung zusammen, nämlich der zum ausdifferenzierten, auf den eigenen Körper abgestimmten Essen. Damit ist nicht gemeint, schädliche Nebenwirkungen zu vermeiden, indem man eine Erkrankung bei der Nahrungsaufnahme berücksichtigt. Mittlerweile lassen Menschen Blut-, Stuhl-, ja Gentests über sich ergehen, um der physiologischen Disposition eine entsprechende Nahrung zu geben, so individuell wie das eigene Mikrobiom.
Sollte sich dieser Trend wirklich durchsetzen, ist es wohl vorbei mit dem gemeinsamen Essen, weil man sich nie mehr auf ein gemeinsames Menu einigen könnte. Schon 1974 hat der hellseherische Regisseur Lous Bunuel in seinem Film „Das Gespenst der Freiheit“ (sic!) die feine Gesellschaft gezeigt, wie sie fröhlich auf Kloschüsseln sitzend palavern, während sie ihre Nahrung auf dem stillen Örtchen allein verzehrten.
Ernst Fischer