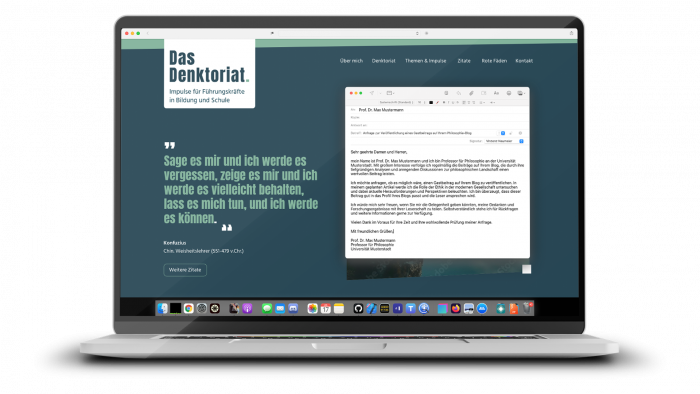Rubrik: Themen und Impulse/Bildung, Religion
09.09.2025 Ernst Fischer / Foto: Erzdiözese Wien
Bildung und religiöse Bildung
… und was auch nicht Nichtglaubende davon lernen können
Bildung ist mehr als das, was uns standardisierte Begriffsformen wie „Bildungsstandards“ oder „Erwachsenenbildung“ zu vermitteln scheinen. Bildung ist zugleich ein Begriff, den alle verwenden, aber oft sehr unterschiedlich. Es ist also an der Zeit, sich zu fragen
Was ist Bildung?
Aus meiner Sicht wird „Bildung“ heute von fünf Wesensmerkmalen bestimmt. Auf diesen fünf Elemente basiert dann auch das, was wir mit „religiöser Bildung“ benennen.
- Der Begriff Bildung umfasst sowohl den Prozess (sich bilden) als auch das Ergebnis des Lernens, als eine Steigerung von Wissen und Fähigkeiten.
- Jeder Mensch ist bildungsfähig, und nur er selbst kann sich bilden. Da Bildung ein selbstreflexives Element besitzt, können zwar andere Menschen Wissen vermitteln, Werte vorleben, aber daraus wird nur dann Bildung, wenn der Einzelne sie reflektiert und in sein Leben einordnet.
- Bildung ist lebensbegleitend und weist im Verlauf dieses Lebens verschiedene Formen auf. Gleichbleibend ist aber die Grundbedingung des Lernens. Ohne das anstrengende Lernen kann man keine Bildung erreichen.
- Bildung zielt auf die Subjektwerdung des Menschen, die in Bewusstsein, Freiheit und Verantwortung mündet.
- Damit verknüpft ist die solidarische und gesellschaftskritische Funktion von Bildung. Erst in der Beziehung zu anderen Menschen können die eigene Unvollkommenheit, aber auch die eigenen Talente wirksam werden.
In diesem Sinne verstanden wehrt sich Bildung gegen die zeitgenössische Vereinnahmung durch Prinzipien wie „Verwertbarkeit“, „Ökonomisierung“ und „nutzbare Brauchbarkeit“. Auch staatliche (oder kirchliche) Vereinnahmung widerspricht diesem Bildungsgedanken. Schließlich gibt es wie oben verstanden keine „Bildungselite“, keine Tendenz, Grenzen zwischen angeblich besser und weniger gut Gebildeten zu ziehen.
Was ist religiöse Bildung?
Alles das, was gerade ausgeführt worden ist, ist auch Teil des Wesens religiöser Bildung. Dazu kommen allerdings folgende Einschränkungen bzw. Erweiterungen. Die Ausführungen beziehen sich nur auf eine jüdisch-christlich-religiöse Bildung.
Einschränkung 1: Im Zentrum steht ein christliches Menschen-, Welt- und Gottesbild. Religiöse Bildung ist zwar offen und frei, ihre Begründung findet sie jedoch in den zentralen Aussagen über Gott und die Welt. Religiöse Bildung hat eine ethische Grundlage. Sie ist also nicht wertneutral, sondern sucht im Gegenteil ethische Grundsätze weiterzugeben und entwickeln zu helfen. Sie will Orientierung geben.
Einschränkung 2: Glaube ist kein Bildungsziel. Religiöse Bildung kann den Menschen nicht zu einem gläubigen Menschen machen. Dementsprechend kann religiöse Bildung heute nicht das Ziel haben, den Glauben weiterzugeben. Glaube und religiöse Bildung bedingen sich, aber Bildung kann Glauben fördern, muss ihn aber nicht.
Erweiterung 1: Religiöse Bildung unterstützt die Sinnsuche im Sinne einer Sinnkonstitution. Es richtet sich an das Bedürfnis des Menschen, nach Sinn zu suchen und gibt ihm die Möglichkeit, eine eigene Haltung zu entwickeln. Damit eröffnet sie neue Räume über die der nichtreligiösen Bildung hinaus.
Erweiterung 2: Dabei ist Bildung des Menschen eine Grunddimension religiösen Handelns, da sie an der Spannung von Gottesebenbildlichkeit und Erlösungsbedürftigkeit, von Freiheit und Verantwortung des Menschen ansetzt. In dieser Spannung wird die Transzendenzbedürftigkeit des Menschen deutlich: Sein endliches Wesen eröffnet dem Menschen einen religiösen Horizont im weitesten Sinne, seine Abhängigkeit und Begrenztheit werden ihm fraglich.
Das zentrale Ziel des Bemühens religiöser Bildung ist also nicht mehr die Vermittlung bestimmter in einer Religionsgemeinschaft geltender Wahrheiten, sondern die Entwicklung von für das Leben in unserer Gesellschaft allgemein wichtigen religiösen Kompetenzen,
Das zentrale Ziel des Bemühens religiöser Bildung ist also nicht mehr die Vermittlung bestimmter in einer Religionsgemeinschaft geltender Wahrheiten, sondern die Entwicklung von für das Leben in unserer Gesellschaft allgemein wichtigen religiösen Kompetenzen, wie die Eröffnung religiöser Erfahrungen (im Umgang mit sich selbst, anderen Menschen und der Natur), die Erschließung religiöser Traditionen (als unterschiedliche Lesarten der genannten Erfahrungen) und die Entwicklung ethischen Identität (und einer dementsprechenden Lebensgestaltung).
Ernst Fischer